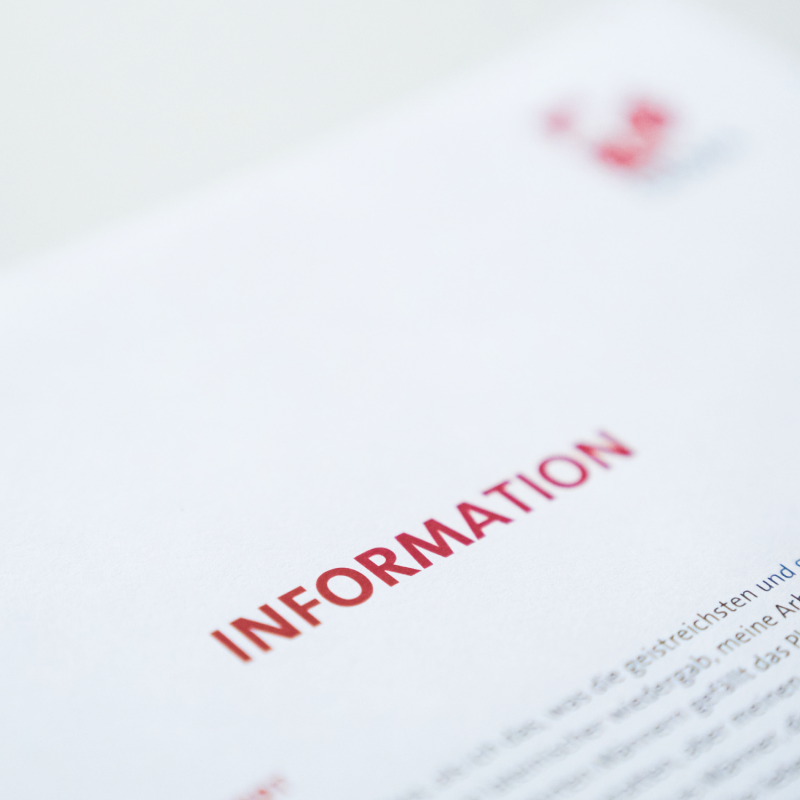
GEMA News
Top-Themen
Aktuelle GEMA News
-
Lesen Sie den Artikel zum Thema Die virtuos im neuen Rhythmus
Die virtuos im neuen Rhythmus
Die nächste virtuos, die im Juli erscheint, informiert Sie in kompakter Form über die von der Mitgliederversammlung 2025 beschlossenen Änderungen im Berechtigungsvertrag.
-
Lesen Sie den Artikel zum Thema Neue Verteilung
Neue Verteilung
Textdichtende aufgepasst: Die GEMA verteilt zum 01.04. erstmals Einnahmen für Nutzungen von Lyrics auf Facebook und Instagram.
-
Lesen Sie den Artikel zum Thema Gesetzliche Vergütungsansprüche
Gesetzliche Vergütungsansprüche
Wie jedes Jahr verteilt die GEMA zum 01.04. an ihre Mitglieder und Schwestergesellschaften Einnahmen aus gesetzlichen Vergütungsansprüchen (GVA) – diesmal für das Geschäftsjahr 2023.
-
Lesen Sie den Artikel zum Thema Information zur Vergabe von kollektiven Lizenzen mit erweiterter Wirkung
Information zur Vergabe von kollektiven Lizenzen mit erweiterter Wirkung
Die GEMA beabsichtigt, kollektive Lizenzen mit erweiterter Wirkung (EKL) zu vergeben.
Eine erweiterte Kollektivlizenz stellt eine besondere Form der Lizenzierung durch eine Verwertungsgesellschaft dar. Sie ermöglicht es uns, Nutzungsrechte auch an Werken von Rechtsinhabern zu vergeben, die nicht direkt mit uns in einem Wahrnehmungsverhältnis stehen (sogenannte "Außenstehende"). -
Lesen Sie den Artikel zum Thema GEMA Infocafé am 6. März in Berlin
GEMA Infocafé am 6. März in Berlin
Die GEMA veranstaltet am 6. März ein Networking- und Informationsevent für alle, die im oder rund um das Music Business tätig sind oder sich für die Musikbranche informieren. Die Veranstaltung findet in der GEMA Generaldirektion Berlin statt.
-
Lesen Sie den Artikel zum Thema GEMA stellt klar: Auch 2024 keine Tariferhöhung für Weihnachtsmärkte
GEMA stellt klar: Auch 2024 keine Tariferhöhung für Weihnachtsmärkte
Musik vermittelt Emotionen, schafft Atmosphäre und trägt zum Gelingen von Veranstaltungen bei – das gilt in der Adventszeit ganz besonders für Weihnachtsmärkte. Musikschaffende schreiben die Lieder, die beim Karneval, beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr oder eben auf dem alljährlichen Weihnachtsmarkt zur Aufführung kommen. Sie haben die Wahrnehmung ihrer Rechte an die GEMA übertragen, um darüber für die öffentliche Nutzung ihrer Werke angemessen vergütet zu werden.
News-Archiv

Newsletter
Mit dem GEMA Newsletter bekommen Sie einmal pro Monat exklusive Interviews, interessante Hintergründe, wichtige Hinweise zu Fördermöglichkeiten oder aktuellen Events und mehr direkt in Ihr E-Mail-Postfach.